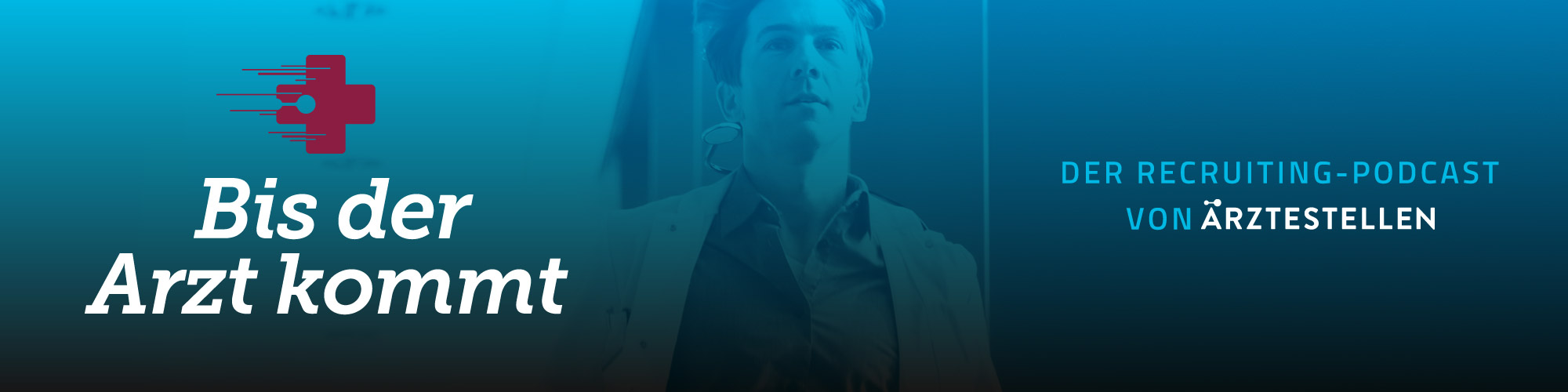Authentizität im Vorstellungsgespräch: Das wünschen sich Arbeitgeber im Allgemeinen von den Bewerbern. Doch heutzutage gilt Offenheit zunehmend auch umgekehrt. Denn aus Bewerbern werden Umworbene. Wie das am besten funktioniert, erklärt Dr. Julia Schäfer, Personalchefin der Uniklinik Bonn.
Die Zeiten ändern sich. Wegen des knallharten Wettbewerbs um Personal ist auch im Vorstellungsgespräch mehr und mehr die Begegnung auf Augenhöhe angesagt. Das bedeutet: Auch potenzielle Arbeitgeber sollten mit offeneren Karten spielen. Das passiert allerdings nicht überall: „Kliniker haben immer noch große Hemmungen, die ausgeschriebene Stelle oder die Situation des Hauses realistisch zu beschreiben, vor allem wenn diese kritisch sind“, sagt Dr. Julia Schäfer, Leiterin Personalentwicklung des Universitätsklinikums Bonn. Doch damit tun sie sich zumeist keinen Gefallen. Enttäuschte Neulinge springen oft wieder ab, manchmal schon während oder, noch schlimmer, nach der Einarbeitung oder Probezeit. Gleichzeitig hat die Klinik es vielleicht verpasst, sich in der Bewerbungsrunde einen passenderen Kandidaten herauszupicken – und alles geht von vorne los.
Keine Worthülsen verwenden
Um das zu vermeiden, rät die Personalexpertin, vor allem auf drei Punkte zu achten: „Der größte Fauxpas ist, wenn der geplante Stellenschlüssel nicht mit der tatsächlichen Besetzung übereinstimmt – und Bewerber erst nach Arbeitsaufnahme frustriert merken, dass die Dienstbelastung dadurch wesentlich höher ist, als gedacht“, warnt Schäfer. Doch auch bei der Beschreibung der Führungskultur geht so manches schief. „In vielen Vorstellungsgesprächen werden populäre Begrifflichkeiten wie ‚flache Hierarchien‘ oder ‚wir sind so agil‘ benutzt, ohne dass dies wirklich stimmt“, erklärt die Gesundheitsökonomin. Schließlich könne es in Abteilungen wie der Unfall- und Viszeralchirurgie, der Kardiologie, der Intensivmedizin oder der geschlossenen Psychiatrie in den Entscheidungsprozessen nun mal nicht basisdemokratisch zugehen. Insbesondere in Unikliniken gibt es quasi die direkte „Befehlsebene“, weil man oft schnell handeln muss. Doch gerade bei jungen Bewerbern wecken solche Worthülsen falsche Erwartungen.
Das trifft auch auf den dritten Stolperstein zu: die Work-Life-Balance. Auch sie wird gerne als Vorteil genannt, kann aber häufig gar nicht gelebt werden. So ist es eben nicht möglich, sich beispielsweise pünktlich aus dem OP zu verabschieden, das gleiche gilt für Rufbereitschaft. „Die Belastung der jeweiligen Position muss im Vorstellungsgespräch klar angesprochen werden. Andererseits sollten Kliniker auch die Erwartungen der Bewerber in dieser Frage sehr sorgfältig erfassen. Wenn diese sagen, sie möchten berechenbare Arbeitszeiten, muss geschaut werden, ob das zu bestimmten Abteilungen oder Instituten passt, für die man verbindliche Zusagen machen kann“, empfiehlt Schäfer.
Nebeneffekt: offenere Bewerber
Auch andere, schwierige Sachlagen, sollten kommuniziert werden: etwa wenn ein neuer Chefarzt eine zerstrittene Oberarzt-Mannschaft übernehmen soll oder ein Team neu aufgestellt wird, das sich immer erst einspielen muss. „Dafür braucht es Kollegen mit einer gewissen Konfliktfähigkeit. Jemand, der sich ins gemachte Nest setzen will, wird mit dieser Situation überfordert sein“, erläutert Schäfer, die in den letzten 14 Jahren viele Kliniken in der DACH-Region kennengelernt und beraten hat. Die Eignung eines Bewerbers dafür lässt sich durch authentische Schilderungen des jeweiligen Szenarios testen – und zwar mit Fragen, wie: "Was würden Sie in dieser Lage tun?" oder "Haben Sie das schon mal erlebt?"
Dadurch wird es übrigens auf beiden Seiten authentischer. Wenn Arbeitgeber eine vertrauensfördernde Atmosphäre schaffen, erfahren sie nebenbei auch mehr über die Kandidaten. Denn diese werden dadurch ermutigt und trauen sich viel eher, auch ihre eigenen Erfahrungen und Vorstellungen ehrlich zu beschreiben. Dies lässt sich zudem nutzen, um einen frischen Blick von außen auf die Institution zu bekommen. Wer zum Beispiel fragt: „Wie war Ihr erster Eindruck von unserer Klinik?“ kann durchaus eine Antwort bekommen, die den Finger in eine Wunde legt – für künftige Verbesserungen.
Doch aufgepasst: Das Image der Klinik darf und sollte selbstverständlich weiterhin gut gepflegt werden, nur eben realistisch sein. Keinesfalls darf der zu besetzende Job schwarzgemalt werden, was im nächsten Schritt übrigens durchaus passieren kann: „Ich habe in der Vergangenheit oft erlebt, dass Bewerber beim Hospitieren verloren gingen. Auf einmal wurden da in extenso die schlimmsten Geschichten der letzten Jahre ausgegraben und erzählt“, erklärt Schäfer. Dieser meist halbe Tag sollte einen echten, gebündelten Eindruck geben. Arbeitgeber sind aber gut beraten, den beteiligten Kollegen zu vermitteln, dass er nicht der Abschreckung dienen darf.
Die Kunst, authentisch zu sein
Um authentisch „rüber zu kommen“, gehört aber noch ein wenig mehr dazu, als Informationen preiszugeben. Es verlangt dem Kliniker auch einiges an Persönlichkeit ab. Klar, gibt es Naturtalente, die sehr strukturiert vorgehen und trotzdem während des Gesprächs aus dem Bauch heraus den Verlauf variieren können. Das ist das Optimum, denn je mehr man von den typischen Fragen wegkommt, umso authentischer wird das Ganze. Wer sich dagegen starr an den üblichen Fragenkatalog hält, bekommt nur viele redundante Aussagen, die nicht sehr aussagekräftig sind. „Manche Bewerber gerade auf Führungspositionen versuchen gezielt ein sozial erwünschtes Profil abzubilden, und das ist dann alles andere als authentisch“, so Schäfer.
Doch nicht jedem ist Souveränität in die Wiege gelegt. „Nicht wenige Kliniker, und natürlich gerade Einsteiger auf diesem Gebiet, hangeln sich an dem Fragegerüst als Gesprächsleitfaden entlang und verschanzen sich regelrecht dahinter“, weiß die Expertin. Aber auch ein Arbeitgeber kann beim Warm-up zugeben, dass er selbst in einer vergleichbaren Situation auch nervös war oder mittels Storytelling die Atmosphäre auflockern. Zudem gibt es verschiedene Schulungen, um Vorstellungsgespräche erfolgreich zu führen. Eine Übung, die man in jedem Fall erledigen kann, ist: Die Beschreibung der Position und der Klinik mit ihren Stärken und Schwächen lässt sich im Vorfeld trainieren. Diese Inhalte und Fragen müssen jedoch untereinander abgestimmt werden, wenn mehrere Kollegen am Auswahlgremium beteiligt sind.
Wirklich passende Kandidaten finden
Authentizität im Vorstellungsgespräch lohnt sich heutzutage mehr denn je. Viele Bewerber dokumentieren ihre Erfahrungen anschließend in den Sozialen Medien, und andere orientieren sich daran. „Insbesondere Mediziner tauschen sich sehr offen untereinander aus. Viele sind gut vernetzt und kennen sogar schon den Flurfunk einer Klinik. Wenn dann nur schöngefärbt wird, kann das zu massiven, nachhaltigen Glaubwürdigkeitsverlusten führen“, weiß Schäfer. Auf der anderen Seite findet mancher gerade Ehrlichkeit so sympathisch, dass er deswegen zusagt: „Wer Hinweise darauf gibt, welche Baustellen einen erwarten und das im Gespräch auf die Person zuschneidet, gewinnt wirklich passende Kandidaten, die dann auch hinter dem Arbeitgeber stehen.“
Zur Person:
Dr. Julia Schäfer hat seit 2019 die Leitung Personalentwicklung in der Universitätsklinik Bonn inne und seit Februar die kommissarische Geschäftsbereichsleitung Personal. Zuvor war sie 13 Jahre Personalberaterin für die Gesundheitsbranche, vor allem für Krankenhäuser. Unter anderem leitete sie bei Kienbaum das Geschäftsfeld „Health Care Executive Search”. Sie ist promovierte Historikerin und Gesundheitsökonomin.